«Korea braucht Reformen wie zu Zwingli-Zeiten»
Frau Chung, Sie lebten rund 15 Jahre in der Schweiz und leiteten die Fachstelle «Frauen und Gender» des evangelischen Werkes «Mission 21» in Basel. Wie steht es eigentlich um die Stellung der Frauen in den reformierten Kirchen von Südkorea?
Die ist nicht viel anders als in der Schweiz oder sonst wo auf der Welt: Die Frauen leisten viel Aufbauarbeit an der Basis. Ist diese aber geleistet und hat sich die Kirche etabliert, wird die Leitung von den Männern übernommen.
Dabei können sich auch in Südkorea Frauen zur Pfarrerin ordinieren lassen und somit Einfluss nehmen.
Nur weil Frauen Pfarrerinnen werden können heisst das nicht, dass sie ihren Beruf auch ausüben können. So ist es beispielsweise unvorstellbar, dass in Südkorea an prestigeträchtigen Kirchen, vergleichbar mit dem Berner Münster oder dem Grossmünster in Zürich, eine Pfarrerin wirkt. Ich bedaure das sehr.
Seit vier Jahren sind Sie auch eine der wenigen Frauen mit einer Professur an der Universität in Seoul.
Ja, die Universität ist leider nach wie vor eine Männerdomäne. Zwar sind die Hälfte unserer Studierenden Frauen, aber nur etwa zehn Prozent der Dozierenden. Dabei verfügt Südkorea seit 1948 über das Frauenstimmrecht – also sehr viel länger als die Schweiz. Trotzdem besteht noch sehr viel Handlungsbedarf, was die Gleichstellung von Frauen betrifft. Auch ist unser Land mit seiner geteilten Geschichte sehr stark von der Militärkultur geprägt, was Auswirkungen auf die Stellung der Frau und generell das Denken der Menschen im Land hat.
Zurück zur Kirche: Die Halbinsel Korea gilt als Missionsland, das einerseits westlich missioniert wurde, andererseits zählt es heute zusammen mit den USA zu den Ländern, die am meisten Missionare in die Welt schicken. In der Schweiz ist der Begriff Mission negativ konnotiert. Warum ist das in Südkorea anders?
Zunächst einmal weil das Land Korea, bestehend aus den zwei Staaten Südkorea und Nordkorea, vor der Teilung 1948 nicht von einem christlichen Land, sondern von Japan kolonialisiert wurde. Das ist weltweit einzigartig – und deswegen existiert diese negative Verknüpfung von Kolonialismus und Christentum nicht. Für uns ist die Mission damit verbunden, dass sie uns den Kirchenaufbau, Schulen und Spitäler brachte. Und ohne Mission gäbe es auch meine Universität nicht. Sie sehen: Mission lässt sich nicht pauschal verurteilen. Aber klar gilt es Aspekte der Mission auch kritisch zu betrachten.
Warum war Korea überhaupt so empfänglich für das Christentum?
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts herrschte eine grosse Enttäuschung über die Dynastien. Diese basierten auf dem Konfuzianismus und Buddhismus. Das Evangelium brachte da die Hoffnung, dass sich die Gesellschaft erneuern kann.
Und wie sieht die Situation der reformierten Kirchen in Korea heute aus?
Wir haben kein grosses Wachstum, aber stabile Zahlen. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung sind Christen. Im Gegensatz zur Schweiz gibt es bei uns sehr viel mehr Kirchgänger und Kirchgängerinnen. Eine grosse Herausforderung sind allerdings die Spannungen zwischen Evangelikalen und Progressiven. Diese äussern sich auch politisch: Evangelikale nehmen die Präsidentin, die wegen Korruptionsvorwürfen ihr Amt niederlegen musste, eher in Schutz, während Progressive für Reformen eintreten. Übrigens, ich rühre in Korea kräftig die Werbetrommel für Zwingli.
Um auf das Reformationsjubiläum hinzuweisen?
Das auch. Aber insbesondere um den Menschen beispielhaft aufzuzeigen, wie sich der Reformator Zwingli für soziale Reformen stark gemacht hat. Gerade jetzt, wo uns der Skandal der früheren Präsidentin sehr beschäftigt, brauchen wir in Korea solche Reformen. Ich stecke aber auch in einem Dilemma: Wenn ich von Zwingli erzähle, fragen mich meine Landsleute regelmässig, wie es denn um die reformierten Kirchen in der Schweiz steht.
Und was antworten Sie?
Ich tue mich schwer mit einer Antwort. Denn jedes Mal, wenn ich in der Schweiz zu Besuch bin, spüre ich den fortschreitenden Bedeutungsverlust der Kirchen. Ich hoffe sehr, dass sie in der Schweiz überleben werden – und mit ihnen ihre Tradition.
In Bern werden Sie als Professorin für systematische Theologie einen Vortrag halten, in dem es hauptsächlich um einen Dichter geht. Wie passen Dogmatik und Poesie überhaupt zusammen?
Poesie kann die Theologie ergänzen. Das ist auch der Grund, weshalb ich in meinem Unterricht oder in meinen Vorträgen gerne Gedichte einbaue: Sie sind kompakt und in ihnen kommt vieles symbolhaft zur Sprache. Auch Karl Barth – über den ich meine Dissertation schrieb – brauchte viele literarische Werke in seiner Arbeit. So nahm er oft Bezug auf Jeremias Gotthelf oder zitierte zu Zeitfragen Hölderlin.
Sie werden auch über den christlichen Dichter Dong-Ju Yun sprechen, der hierzulande unbekannt ist. Was ist die Bedeutung von ihm?
Yun ist nicht nur in der christlichen Welt bekannt, sondern einige seiner Gedichte sind in Korea sogar in Schulbüchern abgedruckt. Ich habe aber auch einen persönlichen Bezug zu ihm: Dong-Ju Yun, der vor genau hundert Jahren geboren wurde, ist ein Absolvent der Universität, an der ich heute tätig bin. Sein Schaffen dokumentiert die Zeit um den Zweiten Weltkrieg. Yun leistete Widerstand mit seinen Texten – und starb schliesslich in einem japanischen Gefängnis während des Zweiten Weltkriegs.
Ist er also das koreanische Pendant zu Dietrich Bonhoeffer?
Nun, beide haben Gedichte geschrieben und beide leisteten auf ihre Art Widerstand. Das gehört für mich zum Reformiert sein: Dem Unrecht ins Gesicht zu blicken und die Stimme zu erheben.
Evelyne Baumberger / ref.ch / 10. Februar 2017
Dieser Artikel stammt aus der Online-Kooperation von «reformiert.», «Interkantonaler Kirchenbote» und «ref.ch».




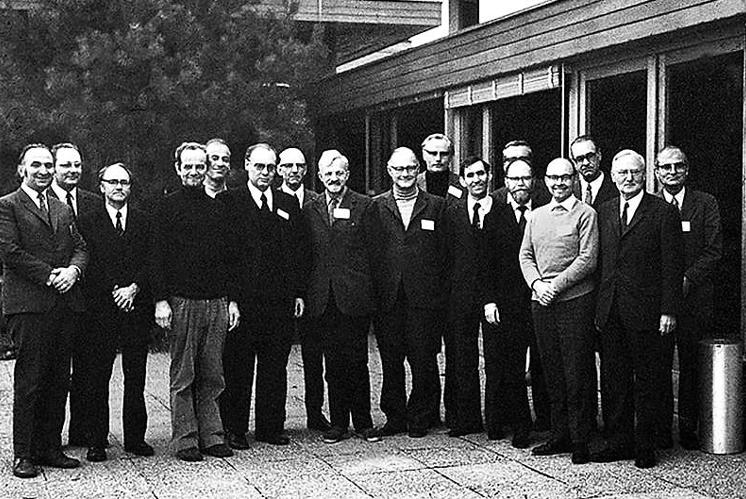

«Korea braucht Reformen wie zu Zwingli-Zeiten»